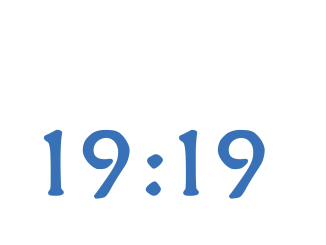[2020-03-03]
Mag. Ingrid Leitner aus der Salzburger Stadtpfarre St. Paul eröffnete mit ihrem Vortrag die 30. Fastenaktion der Halleiner Pfarrgemeinden. Dabei wurde klar, dass Wallfahrten nicht eine „Erfindung“ unserer Zeit sind, sondern dass auch schon im Alten Testament über Pilgerreisen berichtet wird.
Ein herzliches „DANKE“ ergeht an Ingrid Leitner nicht nur für ihren interessanten Vortrag durch gut 3000 Jahre biblische Geschichte sondernauch dafür, dass sie ihren Vortrag in einer Zusammenfassung für all diejenigen zu Verfügung stellt, die nicht dabei sein konnten oder aber noch einmal die eine oder andere Information nachlesen wollten.

Einleitung
Geghard, ein Wallfahrtsort mit Opferplatz in Armenien, bewahrt die alten Traditionen einer Wallfahrt im biblischen Stil.
Schilo, Ort der Bundeslade und stämmeübergreifendes Kultzentrum der Zeit vor 1000 vor Chr.
Am Heiligtum von Schilo versah die Priesterfamilie der Eliden den Dienst. Mit Schilo verbinden sich auch die Erinnerungen um Herkunft und Jugend des Propheten Samuel und die tragische Geschichte der Eliden.
Der Erzählkreis um Hanna
1 Sam 1,1-1,28 ist eine typische sogenannte Kindheitsgeschichte, eine Ouvertüre zu einer Komposition. Die spätere Bedeutung eines Menschen verdichtet sich zu einem von Gott gestifteten Ursprung. Samuel ist ein Neuanfang. Er beginnt mit dem Schicksal seiner Mutter Hanna.
Hanna war die Hauptfrau des Efraimiters Elkana. Sie bleibt kinderlos, damals war das ein schweres Schicksal. Das Ausbleiben des Kindersegens wurde der Frau angelastet. Elkanas zweite Frau Peninna hatte Kinder.
Jedes Jahr unternahm die Familie eine Wallfahrt nach Schilo, um Gott anzubeten und ihm zu opfern. Wir bekommen einen Einblick, wie sich der Aufenthalt an einem solchen Wallfahrtsort gestaltete. Elkana bringt das Opfer dar. Das geopferte Tier wird aufgeteilt. Einige (wertvolle) Teile gehören Gott – sie werden verbrannt. Die anderen Teile werden gekocht, und davon dürfen sich die Priester und ihre „Lehrlinge“ für ihre Familien nehmen. Die übrigen Teile verzehren die Familie und ihre Angehörigen im Gelände des Wallfahrtsortes. Elkana gibt allen Familienmitgliedern ihre ihnen zustehenden Anteile. Hanna aber gibt er doppelt. Er liebt sie, obwohl sie kinderlos ist. Peninna aber kränkt und demütigt Hanna: Sie hat Kinder – Hanna nicht. So geht das Jahr für Jahr.
In 1 Sam 1,7 heißt es: „7Peninna kränkte sie und Hanna weinte und aß nichts. 8Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna, warum weinst du, warum isst du nichts, warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne?“
Nach dem Essen und Trinken stand Hanna auf und ging allein in das Heiligtum. Der Priester Eli saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Heiligtums. Hanna weinte ihre Verzweiflung heraus, machte Gott ein Gelübde, dass sie, wenn sie einen Sohn bekäme, ihn Gott überlassen würde. Lange sprach sie mit Gott in ihrem Herzen. Ihre Lippen bewegten sich. Weil ihre Stimme nicht zu hören war, hielt Eli sie für betrunken und schimpfte mit ihr: „Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen. Sieh zu, dass du deinen Weinrausch los wirst!“ Aus der Antwort Hannas, dass sie weder Wein noch Bier getrunken habe, erkennt man, dass alkoholische Getränke zu so einem Fest offenbar dazu gehörten. Hanna erklärte Elli, dass sie aus großem Kummer und aus großer Traurigkeit so lange mit Gott geredet habe. Eli wünschte ihr Frieden und gab ihr die Zuversicht, dass Gott ihr die Bitte erfüllen werde. Und es heißt: „Dann ging sie weg. Sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr.“ (1 Sam 1,18)
Üblicherweise – das kann man auch aus dem Text erkennen – übernachtete die Familie am Gelände des Heiligtums. Dann wurde früh aufgestanden, es folgte ein Gebet, und dann wurde der Heimweg angetreten.
Hannas Wunsch ging in Erfüllung. Sie gebar einen Sohn, nannte ihn Samuel – „Ich habe ihn von El (Gott) erbeten“.
Bei der nächsten Wallfahrt zog Elkana mit seiner ganzen Familie hinauf nach Schilo. Hanna blieb zu Hause und erst, als sie das Kind entwöhnt hatte (damals frühestens mit 3 Jahren), brachte sie entsprechend ihrem Gelübde Samuel zu Eli.
Weitere Informationen über Wallfahrt damals
Einige weitere Informationen über den Betrieb eines Wallfahrtortes erfährt man auch noch: Elis Söhne, Hofni und Pinchas, sind Priester des Herrn am Wallfahrtsort. Die Priesterschaft war erblich, die ganze Familie war am Wallfahrtsort tätig.
Noch etwas wird berichtet: Das Schlachtopfer wird dargebracht, der Gott gehörende Teil (= das Fett) verbrannt. Dann wird das Fleisch gekocht. Diener des Priesters durften eine dreizinkige Gabel verwenden, damit in den Kessel oder Topf hineinstoßen, und alles, was die Gabel heraufholte, gehörte dem Priester bzw. ihm und seiner Familie. Die Söhne Elis missachteten den Brauch und nahmen, was ihnen nicht zustand. Laut 1 Sam 2,15ff nahmen sie schon vor der Opferhandlung, dem Verbrennen des Fettes, den priesterlichen Anteil, um ihn abseits der Opfermahlzeiten zu braten statt zu kochen. (Text: 2 Sam 2,15-17)
Eine weitere Information, die offensichtlich später in den Text aufgenommen wurde, ist die, dass die Priestersöhne mit den Frauen, die sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes aufhielten, sexuelle Beziehungen unterhielten. Die Verse sind in ihrer Bedeutung unklar und hängen laut Kommentar zu den Samuelbüchern von Silvia Schroer damit zusammen, dass man sich in späterer Zeit nicht mehr vorstellen konnte, was die wirklichen Vergehen der Priestersöhne Hofni und Pinchas gewesen sein mochten.
Psalmen: Was macht die Psalmen aus?
- Alles, was Menschen erleben, wird wie ein liturgischer Akt erfahren, als fröhliches Fest, als traurige Klagefeier. Menschen führen ein Leben im Angesicht Gottes und vertrauen sich ihm an. Sie schütten vor Gott ihr Herz aus und flehen um Gottes Eingreifen.
- Die Menschen erleben sich und ihre Welt als gefährdet, das Böse hat die Möglichkeit, die Strukturen der Welt zu prägen.
- Die Bilder, die in den Psalmen verwendet werden, sind oft heftig. Sie wirken auf uns oft befremdlich und widersprüchlich.
Wessen Stimme hören wir:
Die Stimmen der Bedrückten, derer, die in wirklicher Bedrohung leben, für die es um Leben und Tod geht. Die Stimmen der zutiefst Geängstigten, der Gewaltopfer, die sich nicht den Mund verbieten lassen. Sie schreien zu einem DU, rufen umso lauter, wenn sie es als abwesend erleben. Wir können in Solidarität mit ihnen beten oder sind selbst in einer solchen Situation.
Zu wem sprechen die Psalmen?
Zu Gott, er ist der einzige, der helfen kann.
Wallfahrtspsalmen
Wallfahren-Pilgern wird oft als Metapher für unseren Lebensweg verwendet. Von den 150 Psalmen werden die Psalmen 120 bis 134 als Wallfahrtslieder bezeichnet. Im Titel kommt meist vor „Lied zum Aufstieg“ / „Lied des Aufstiegs“. Gemeint ist der Aufstieg nach Jerusalem, das etwa 800 m über dem Meeresspiegel liegt. Aus jeder Richtung geht der Weg hinauf. Zu den drei Hauptfesten (Pascha, Wochenfest, Laubhüttenfest) pilgerten die Israeliten durchs judäische Bergland zum Jerusalemer Tempel.
Eine besondere Bedeutung im Rahmen der ökumenischen Fastenaktion 2020 hat der Psalm 121.
Psalm 121
1Ein Lied für die Wallfahrt.
Ich erhebe meine Augen zu den Bergen:
Woher kommt mir Hilfe?
2Meine Hilfe kommt von Gott,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
3Er lässt deinen Fuß nicht wanken;
dein Hüter schlummert nicht ein.
4Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht,
der Hüter Israels.
5Gott ist dein Hüter,
Gott gibt dir Schatten zu deiner Rechten.
6Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden
noch der Mond in der Nacht.
7Gott behütet dich vor allem Bösen,
er behütet dein Leben.
8Gott behütet dein Gehen und dein Kommen
von nun an bis in Ewigkeit.
Berühmte Vertonungen des Psalm 121: Heinrich Schütz (SWV 31); Mendelssohn-Bartholdy (op 78)
Der Zion und die Zionstheologie
Ein großer Sehnsuchtsort bis heute ist der Zion geworden und geblieben.
Ursprünglich war der Zion eine Turmburg der Jebusiter (2 Sam 5,7) an der südöstlichen Stadtgrenze des vorisraelitischen Stadtstaats Jerusalem. Entgegen aller Einschätzungen konnte David sie erobern und machte sie zu seinem Königssitz und zum kultischen und politischen Mittelpunkt seines Reiches (2 Sam 5). Er wählte diese Stadt, weil sie ungefähr auf der Grenze zwischen den Gebieten der israelitischen Nordstämme – dem späteren Nordreich Israel – und der Südstämme – dem späteren Südreich Juda – lag und beiden Gebieten die bis dahin fehlende territoriale Geschlossenheit gab.
David überführte die Bundeslade nach Jerusalem (2 Sam 6), damit band er die religiösen Traditionen des früheren Stämmebundes an seinen Königssitz und ermöglichte deren Verbindung mit Elementen der im Stadtstaat Jerusalem gepflegten Religion Kanaans. Von dem Hofpropheten Natan erhielt er wohl nach seinen Siegen über die Nachbarkönige und erfolgreicher Ausdehnung seines Reiches die Zusage des ewigen Bestandes seiner Dynastie (2 Sam 7,8 ff.). Daran knüpfte die spätere Zionstheologie an.
Davids Sohn Salomo baute den vorhandenen jebusitischen Stadttempel zum Tempel Gottes um (etwa 930 vor Chr.). Auf diesen idealisierten Platz konzentrierte sich die Theologie, die man Zions-Theologie nennt und die heute noch in orthodoxen Kreisen des Judentums wichtig ist. Sogar das Urchristentum trug diese Zions-Erwartung weiter.
Wallfahrtsorte sind oft nicht nur ein kultisches Zentrum, sondern auch ein politisches. Der Tempel in Jerusalem wurde zu einem ganz wichtigen Zentrum für das Reich Davids bzw. Salomos.
Im Jahr 586 vor Chr. zerstörten die Babylonier Jerusalem und den Tempel. Zion wurde von da an Ort der Erinnerung und Sehnsucht. Die Haltung beim Gebet wurde nach dem Zion ausgerichtet. Im Zuge der Herrschaft der Perser konnten Juden und Jüdinnen zurückkehren. Der Tempel wurde wieder aufgebaut (ca. 520 bis 515 vor Chr.) und erneut kultisches Zentrum des Judentums. In dieser Zeit entstand eine ausgeprägte Zionstheologie: Die Völker werden zum Zion pilgern und Gott anbeten (Jes 56,7; 60,1-5).
Völkerwallfahrt zum Zion und Universalismus
Jes 56,7: Gemeinsame Anbetung des einzigen Gottes auf dem Zion.
Jes 56
1So spricht Gott: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit,
denn bald kommt mein Heil
und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren!
2Selig der Mensch, der dies tut,
und jeder Einzelne, der daran festhält, den Sabbat zu halten
und ihn nicht zu entweihen und seine Hand vor jeder bösen Tat zu bewahren.
3Der Fremde, der sich Gott angeschlossen hat, soll nicht sagen:
Sicher wird er mich ausschließen aus seinem Volk.
Der Eunuch soll nicht sagen: Sieh, ich bin ein dürrer Baum.
4Denn so spricht Gott:
Den Eunuchen, die meine Sabbate halten, die wählen, was mir gefällt
und an meinem Bund festhalten,
5ihnen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Namen.
Das ist mehr wert als Söhne und Töchter:
Einen ewigen Namen gebe ich einem jeden, der nicht ausgetilgt wird.
6Und die Fremden, die sich Gott anschließen,
um ihm zu dienen und den Namen Gottes zu lieben,
um seine Knechte zu sein,
alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen
und die an meinem Bund festhalten,
7sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen
und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets.
Ihre Brandopfer und Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden,
denn mein Haus
wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden.
8Spruch Gottes, des Herrn, der die Versprengten Israels sammelt:
Noch mehr, als ich schon von ihnen gesammelt habe, will ich bei ihm sammeln.
Das bedeutet volle Akzeptanz im Kult Jerusalems.
Dagegen: Laut Dtn 23,2 dürfen Eunuchen nicht in die Versammlung Gottes kommen. Laut Neh 9,2; 13,1-3 (und andere) sollen Fremde aus dem Volks- und Religionsverband Judas ausgeschieden werden.
Gott hat den Zion als Ort seines Heils gewählt: Folgende Psalmen werden als Zionspsalmen bezeichnet: 46, 48, 76, 84, 87, 122, 132.
Wir singen in der Adventzeit gerne das Lied „Tochter Zion“. Zion ist im Lauf der Zeit immer mehr anthropomorph ausgestaltet worden, als Braut Gottes, als Königin, als geachtete Mutter vieler Kinder. Die „Tochter Zion“ steht zwischen Gott und dem Volk Gottes, in einer jeweils eigenen Beziehung, je nach der Stellung, die man ihr gerade zuschreibt.
Für das Neue Testament prägend wurden die Verse Sach 9,9-10:
Sach 9
9Juble laut, Tochter Zion!
Jauchze, Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir.
Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil,
demütig ist er und reitet auf einem Esel,
ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin.
10Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Efraim
und die Rosse aus Jerusalem,
ausgemerzt wird der Kriegsbogen.
Er wird den Nationen Frieden verkünden;
und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer
und vom Strom bis an die Enden der Erde.
Sacharja 9-11 enthält vielleicht Hinweise auf den Siegeszug Alexanders des Großen. In Jerusalem wird kein fremder Herrscher, sondern der von Gott gesandte Friedenskönig einziehen. Für die Christen wird Jesus zum Messias, durch den alle Völker den Bundesgott Israels kennen lernen und anerkennen sollen.
Von der spät-nachexilischen Zeit bis zu Jesus
Üblich waren Wallfahrten nach Jerusalem 1-3mal im Jahr. Aber dass alle jüdischen Männer Israels 3-mal im Jahr nach Jerusalem pilgerten, darf bezweifelt werden, 1-mal im Jahr wird es schon gewesen sein. Gläubige in der Diaspora bemühten sich, es einmal im Leben zu schaffen.
Einer, der es ganz genau genommen hat, war Tobit.
Das Tobit-Buch ist eine romanhafte Lehrerzählung. Es entstand in der Mitte des 2. Jhds. vor Chr. und ist ein Muster volkstümlicher, erzählerischer Theologie.
An den Hauptpersonen des Buches Tobit erkennt man ein typisches Diaspora-Schicksal. Das heißt, die Menschen wohnten in verschiedenen Gegenden der Großreiche und waren als Mitglieder der jüdischen Gemeinden ihrem Glauben treu.
Tobit hielt an den Wallfahrten fest und ging nach Jerusalem und hielt die kultischen Regeln ein bis ins kleinste Detail.
Jesus als Pilger
Das Lukasevangelium geht davon aus, dass die Eltern Jesu jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem gegangen sind.
- Lk 2,41: Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem.
- Lk 2,42: Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach.
- Lk 2,43: Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten.
- Lk 2,44: Sie meinten, er sei in einer Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten …
Das Johannesevangelium beschreibt, dass Jesus zum Sukkot (Laubhüttenfest, Erntefest im Herbst) in Jerusalem war (Joh 7).
Im 10. Kapitel des Johannesevangeliums wird erzählt, dass Jesus im Winter beim Tempelweihefest (Chanukka) in Jerusalem war.
Alle vier Evangelien berichten, dass Jesus zum Pessachfest nach Jerusalem gegangen ist. Am Pessachfest des Jahres 30, am 7. April 30, fand Jesus seinen Tod am Kreuz.
Jesus war dem Tempelkult gegenüber kritisch eingestellt, vor allem dort, wo er darin eine Verzweckung der Gottesverehrung sah. Johannes der Täufer hatte weit weg vom Tempel mit der Taufe am Jordan einen Versöhnungsritus geschaffen. Auch Jesus predigte, dass das Reich Gottes nicht an einen Ort gebunden ist, sondern dass es da ist und wirkt.
Im Jahr 70 wurden im Jüdischen Krieg Jerusalem und der Tempel Jerusalems durch die Römer zerstört. Es gab schon etwa zweihundert Jahre davor Synagogen-Gemeinden. Die Ablösung vom Tempelkult und Neuorganisation des Judentums und der jüdischen Religion gelang durch das Wirken und die Weisheit der jüdischen Rabbiner, zumeist aus der Tradition der Pharisäer.
Verwendete Literatur
- Die Bibel
- Herders Neues Bibellexikon, Freiburg im Breisgau, 2008
- Thomas Staubli, Begleiter durch das Erste Testament, Patmos-Verlag 21999
- Silvia Schroer, Die Samuelbucher, NSK-AT 7, Stuttgart 1992
- Welt und Umwelt der Bibel, Nr. 82, 4. Quartal 2016