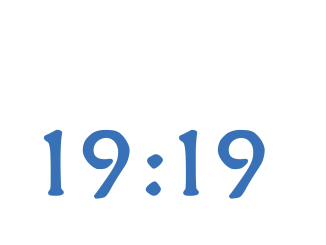[26.06.2020]
Nähe und Distanz, diesen Titel haben wir im Redaktionsteam für den Gemeindebrief ausgewählt. Auf den folgenden Seiten stellen wir verschiedene Aspekte dieses Themas dar! Viel Freude und vielleicht auch die eine oder andere Anregung beim Lesen!
Wenn Begegnungen und Kontakte zu Problemen werden
„Drent und herent“ im Haus der Barmherzigkeit
Verbote, eindringliche Empfehlungen, Einschränkungen und Begrenzungen prägten unseren Alltag und die Medienberichte in den letzten Wochen. Sie sind Folgen einer weltweiten Pandemie und werden uns noch lange beschäftigen.
Mit nicht weniger dramatischen Auswirkungen wurden wir durch das Erinnern an das Kriegsende vor 75 Jahren zusätzlich konfrontiert. Bild- und Tondokumente berichteten uns von Grenzziehungen, Kontaktabbrüchen, seelischen und körperlichen Leiden sowie dramatischen, wirtschaftlichen Problemen.
Wie (über)lebenswichtig für uns Kontakte und Begegnungen sind, zeigt uns das aktuelle Ringen um die vollständige Rückgewinnung unserer gewohnten Freiheiten, die alle Lebensbereiche betreffen. Was uns abhanden gekommen ist, wird uns von Tag zu Tag bewusster.
Und was historische Ereignisse bewirken und wie diese einst „gemildert“ werden konnten, soll an Hand der Geschichte eines grenznahen Berghauses erzählt werden.
Die Gründung des Österreichischen Alpenvereins im Jahre 1862 und seine Fusionierung mit dem Deutschen Alpenverein 1873 entfachte eine beeindruckende „Gründerbewegung“ von Sektionen in beiden Ländern. In unserer näheren Umgebung entstanden die Sektionen Salzburg (1870), Berchtesgaden (1875) und Golling (1880).
Ein Anliegen für den damaligen Bürgermeister von Hallein Alois Oedl war es, auch in der Salinenstadt eine Sektion des Alpenvereins ins Leben zu rufen, was am 8. Dezember 1884 auch gelang.
Die neue Sektion war ein „Kind der Zeit“, die von einer wachsenden Naturbegeisterung der damaligen Bevölkerung geprägt war. Die Schönheiten der Landschaft, die Urgewalten der Natur, Sonnen-Auf- und Untergänge bekamen eine, bei vielen bisher nicht so empfundene, emotionelle Bedeutung.
Die großen Gipfelbesteigungen und Bergfahrten waren vorerst noch nicht das Ziel der Bergfreunde. Almwanderungen und leicht erreichbare Gipfel erfreuten sich großer Beliebtheit. Durch die Anlage von Wanderwegen in der Umgebung, deren Markierung, durch Einbauten von Sicherungen und die Aufstellung von Ruhebänken an besonders attraktiven Stellen legten die Alpenvereine dafür die nötige Infrastruktur.
 Ein halbes Jahr nach seiner Gründung trat man an den „wohllöblichen Centralausschuss des DuOeAV“ in Wien mit dem Vorschlag heran, „am Fuße des Hohen Göll eine Unterkunftshütte zu errichten“, wozu ein Betrag von 2500 Gulden zu entrichten gewesen wäre. Die junge Halleiner Sektion konnte den geforderten Betrag aber nicht annähernd aufbringen und bekam vom Wiener Zentralausschuss eine Absage.
Ein halbes Jahr nach seiner Gründung trat man an den „wohllöblichen Centralausschuss des DuOeAV“ in Wien mit dem Vorschlag heran, „am Fuße des Hohen Göll eine Unterkunftshütte zu errichten“, wozu ein Betrag von 2500 Gulden zu entrichten gewesen wäre. Die junge Halleiner Sektion konnte den geforderten Betrag aber nicht annähernd aufbringen und bekam vom Wiener Zentralausschuss eine Absage.
Das gleiche Schicksal erfuhr auch die Sektion Salzburg im Jahre 1898, als sie auf Grund anderwärtiger, finanzieller Belastungen auf den Bau eines Göllhauses ebenfalls verzichten musste.
Bei der thüringischen Stadt Sonneberg stieß diese Idee auf großes Interesse. Als damalige „Weltspielwarenstadt“ erfreute sie sich einer hohen Wirtschaftsleistung. Durch die Vermittlung des legendären Bergsteigers Ludwig Purtscheller, der in Salzburg als Turn-Pädagoge tätig war, wurde nun durch die Sektion Sonneberg ein Grundstück am Eckerfirst erstanden und am 22.Juli 1900 wurde zur feierlichen Eröffnung einer Schutzhütte geladen.
Ein Kuriosum stellt die besondere Situierung des Hauses dar – und diese prägte auch die ersten Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs.
Was man 1900 beim Bau noch nicht wusste, erwies sich aber später für viele als Segen: Ein Drittel des Hauptgebäudes steht nämlich auf bayerischem Boden, zwei Drittel liegen in Österreich. Die Grenze verläuft oft mitten durch einzelne Räume. Die verschiedenen „Hoheiten“ bargen deshalb auch immer zoll- und devisenrechtliche sowie polizeiliche Probleme in sich. Die strengen, behördlichen Auflagen wurden immer von Beamten beider Staaten bis zum EU-Beitritt Österreichs geprüft. Bei Begehungen traf man sich meist gemeinsam.
Durch die außergewöhnlichen Grenzverhältnisse innerhalb des Gebäudes wurde das Purtschellerhaus nach 1945 faktisch ein „exterritoriales Gebiet“.
Der Grenzverkehr zwischen den beiden Staaten wurde 1945 verboten und die einzige legale Gelegenheit für Menschen von „drüben und herüben“ sich zu begegnen, wurde nun durch die groteske Lage dieses Hauses möglich. Rechts vom Grenzzaun, der vom Eckersattel steil nach oben zog, stiegen die deutschen Wanderer hinauf – links am Gebirgshang kam man aus dem Salzburgischen in Serpentinen ins Haus, um sich für zumindest ein paar Stunden zu treffen. Das „Haus der Barmherzigkeit“ oder der „Treffpunkt der Liebe“ musste im Jahre 1946 20.000 Nächtigungen, 1947 19.000 und 1948 – nach den Lockerungen der Grenzbestimmungen – noch immerhin 13.000 Übernachtungen verkraften. 1949 normalisierte sich der Besucherstrom – das Haus wurde wieder primär zum alpinen Stützpunkt.
Die politische Situation nach dem 2. Weltkrieg hatte auch eine völlige Auflösung sämtlicher DuOeAV-Sektionen im sowjetischen Besatzungsgebiet zur Folge. Dies betraf somit auch die Sektion Sonneberg in Thüringen und damit verbunden ergab sich die Notwendigkeit einer treuhänderischen Verwaltung des Purtschellerhauses durch die Sektion Hallein für den österreichischen Teil („Deutschen Eigentums im Ausland“) und durch die Sektion Berchtesgaden für den bayerischen Teil. Nach einigen Jahren übernahm schließlich Berchtesgaden die gesamte Verwaltung. Erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 kehrte das Purtschellerhaus wieder in die alte thüringische „Heimat“ nach Sonneberg zurück.
Wolfgang Guttmann